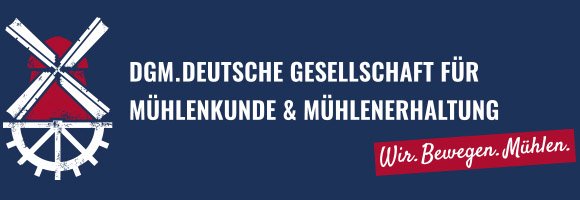1. Vorwort

Mit diesem Handbuch möchten wir Ihnen einen Leitfaden und Anregungen bieten für die Vorbereitung, den Aufbau und die Durchführung einer Mühlenführung.
Unsere Mühlen sind von der Art, dem Erhaltungszustand und den damit verbundenen Präsentationsmöglichkeiten sehr verschieden. Daraus ergeben sich unterschiedliche Schwerpunkte und Chancen. Unseren Schwerpunkt bilden die Getreidemahlmühlen. Ebenso unterschiedlich sind das Wissen und die Erfahrung der Mühlenführerinnen und Mühlenführer. Neue müssen sich einarbeiten. Mühlen sind Lernorte für alle: Von Kindergarten über Schule bis zu Erwachsenen. Sie sind Lernorte, die alle Sinne ansprechen.
In verschiedenen Themenblöcken finden Sie Informationen und Anregungen, mit denen Sie Ihre Führung individuell zusammenstellen und ausgestalten können. Besonders stolz sind wir auf unsere „Aha-Stationen“. Durch Anschauen, Mitmachen und Ausprobieren sollen große und kleine Besucherinnen und Besucher das Leben und die Technik rund um eine Mühle erleben und verstehen – eben per „Aha-Effekt“!
Unserem Handbuch haben wir Beispiele von Mühlenführungen angefügt sowie Literaturangaben. Wir möchten besonders auf unsere „Erklärvideos“ hinweisen, mit denen Sie Ihre Erläuterungen unterstützen können. Und - wenn wir Ihnen mit unseren Hinweisen zur „Spurensuche“ neue Ideen vermitteln können, freut uns das!
Unsere Mühlen haben so viel zu erzählen! Werden Sie zu ihren Botschaftern!
Glück zu!
Außerhalb der Schule zu lernen, das ist an vielen Orten möglich und sinnvoll. Die Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, werden durch die besondere Umgebung und die Erfahrungen eindrucksvoll und nachhaltig. Das haben auch die Schulämter erkannt und vermitteln den Schulen entsprechende Bildungsangebote.
Eine Mühle kann ein ganz vielfältiger Lernort sein. Das Thema „Vom Korn zum Brot“ ist ein klassisches Thema im Sachunterricht der 3. Klasse in der Grundschule. Aber auch für weiterführende Schulen bis hin zu den Berufsschulen sind Mühlen interessante Lernorte, denn sie zeigen zum Beispiel „analoge“ Maschinentechnik in vielfältigen Entwicklungsstufen und machen Funktionsweisen nachvollziehbar. Inzwischen gibt es landesweite Netzwerke, an denen man sich als Anbieter orientieren kann. In NRW gibt es zum Beispiel das Netzwerk „Kulturstrolche“. Dort erfahren Sie unter anderem, welche Anforderungen an einen Lernort gestellt werden.
Nutzen Sie also die Möglichkeit sich zu vernetzen! Im Schulamt in Ihrem Rathaus oder im Kreishaus bekommen Sie Informationen und Unterstützung, um Ihre Mühle als Lernort anzubieten. So erhalten Sie Gelegenheit, sich als Lernort nicht nur Schulen und Kindergärten in der Nachbarschaft zu präsentieren, sondern ihren Bekanntheitsradius zu erweitern. Wenn Kinder begeistert von Ihrer Mühle berichten, interessieren sich oft auch die Eltern und kommen.
Um mehr über Lernorte herauszufinden, ist auch eine Recherche im Internet hilfreich!
Eine ausführliche Beschreibung, wie der Lernort Mühle gestaltet sein kann, finden Sie zum Beispiel unter „Britzer Mühle“.
Schauen Sie auch in unseren „Aha-Stationen“ nach! Dort finden Sie Themen, Anregungen und Mitmach-Ideen.
Gerne dürfen Sie unsere „Erklär-Videos“ (7.6) und weitere Materialien (7.5) nutzen!
Einst haben Mühlen ihre Umgebung geprägt. Allerorten fanden sich derartige Anlagen. Vor allem auf dem Land fanden sich überall diese Bauwerke, die zum Mahlen von Getreide dienten. Spätestens in den 1950er- und 1960er-Jahren verschwanden viele Mühlen und mit ihnen Wissen und Kenntnis über ein altes Handwerk. Gerade deshalb lohnt es sich, auf Spurensuche zu gehen! Überall finden sich nämlich Spuren und Zeugnisse früherer Mühlen und deren Bedeutung in ihrem Umfeld.
Beispielsweise belegen Straßen-, Flur-, Orts- und Familien- beziehungsweise Hofnamen das Vorhandensein einer Mühle. Des Weiteren künden zahlreiche Schriftstücke in Archiven von der Geschichte dieses Gewerbezweiges. Auch bauliche oder archäologische Hinterlassenschaften berichten von der Vergangenheit des Mühlenwesens. Mitunter können zudem noch Zeitzeuginnen oder Zeitzeugen von ihren Erinnerungen berichten.
In unserem Informationsportal werden an mehreren Stellen Anregungen zur eigenen Spurensuche gegeben. Diese Hinweise sollen Tipps zu weitergehenden Recherchen liefern und eigene Forschungen anstoßen.
In Ihrer Führung sollten Sie möglichst nur die wesentlichen Daten aus der Zeitgeschichte der Mühle erzählen. Gleichwohl sollten Sie auf Fragen vorbereitet sein. Falls Sie mal eine Frage nicht beantworten können, ist das keine Schande. Dann stehen Sie dazu und nehmen die Frage als Anregung auf, sich sachkundig zu machen!
Hier die wesentlichen Punkte:
- Ersterwähnung
- Anlass
- Mühlentyp
- Bauabschnitte (Modernisierungen)
- letzter Müller
- Jetziger Besitzer
- Instandsetzungen bis heute
Wir empfehlen, bei Führungen mit Schulkindern die Geschichte der Mühle auszulassen.
Anmerkungen / Ergänzungen
Je nach den örtlichen Begebenheiten und technischen Zustand Ihrer Mühle können Sie prüfen, ob Sie in Ihrer Führung einen Themenschwerpunkt vertiefen. In einer allgemeinen Führung wird man nur einen Bereich ausführlicher vorstellen und an anderer Stelle kürzen, um den Rundgang nicht zu überfrachten.
Denkbar ist auch eine Führung gleich unter ein spezielles Thema zu stellen und anzubieten. Vielleicht erreicht man damit neue Interessenten.
Vertiefende Themenschwerpunkte können sein:
- Mühlentechnik intensiv (Kleinstgruppe)
- ausführliche Geschichte der Mühle und ihre Instandsetzung
- Mahltechniken von früher bis heute
- Müllerberuf im Wandel der Zeit
- Mühle in Gefahr
- Mühlenrecht / Wasserrecht
- Mühlen in Literatur, Märchen und örtlichen Sagen
- Vom Feld zur Mühle (Erntetechniken)
- Vom Korn zum Brot
Besucher
Wer besucht unsere Mühle?
An offenen Mühlentagen wird es eine bunte Mischung sein. Bei gebuchten Führungen weiß man um die Alterszusammensetzung, die Gruppengröße und möglichweise um einen gewünschten Themenschwerpunkt. Entsprechend sind Vorbereitungen zu treffen.
Ein wichtiger Aspekt ist Barrierefreiheit: Muss ich mich auf einfache Sprache einstellen? Sind Personen mit Handicap dabei? Wie kann ich ihnen einen Besuch ermöglichen bzw. wo sind räumliche Grenzen erreicht?
Der Umfang des Rundgangs und der Erläuterungen sollten dem Alter der Besucher angepasst sein. Die Spanne liegt zwischen Grundschulkindern und fachkundigen Besuchern. Wir empfehlen daher, bei Führungen mit Grundschulkindern die Geschichte der Mühle auszulassen bzw. nur kurz darauf einzugehen.
Alles ist vorbereitet:
Zuständigkeiten während der Führungen bzw. am Mühlentag sind geregelt. Die Mühle präsentiert sich in einem aufgeräumten Zustand. Gefahrenstellen sind abgegrenzt und markiert. Die Gruppenstärke und der Zeitrahmen bei den Führungen ist festgelegt. Der Ablauf ist klar, zeitlich getaktet und besprochen. Die Objekte sind zugänglich. Das Material passt zu verschiedenen Altersgruppen und liegt bereit. Die Müller, die die Führungen durchführen, tragen Namensschildchen (und / oder sind an ihrer Kleidung zu erkennen). Sie wissen, wo Sie Station machen, und haben sich überlegt, wo Sie stehen und wo die Gäste. Achten Sie darauf, dass Umgebungslärm nicht zu sehr ablenken kann bzw. stellen Sie sich (und Ihre Gäste) darauf ein!
Mit dem Gefühl, gut vorbereitet zu sein, steigt die Vorfreude auf die Besucher!
Egal, ob Ihre Besucher Kinder oder Erwachsene sind: Ihre Gäste sind gespannt auf etwas Neues - auf Ihre Mühle - und freuen sich auf einen Rundgang mit Ihnen.
Begrüßung
Suchen Sie sich einen Platz vor der Mühle, wo Sie gut zu sehen und zu hören sind!
Nehmen Sie sich Zeit für die Begrüßung: Zeigen Sie sich und warten Sie ab, bis Sie die Aufmerksamkeit aller haben! Das kann manchmal etwas Geduld erfordern. Schauen Sie Ihre Gäste lächelnd ins Gesicht. (Stellen Sie sich vor, Ihre Geburtstagsgäste sind eingetroffen und freuen sich auf die Zeit mit Ihnen! Das hilft, das eigene Lampenfieber zu dämpfen.)
Kinder äußern ihre Spannung oft mit Unruhe. Um so ruhiger sind Sie: Ein unruhiges Kind sprechen Sie einfach an „Gleich geht`s los, psst!“ und - lächeln! Außerdem: Sie dürfen von den erwachsenen Begleitern der Kinder (Lehrer, Eltern, ..) Unterstützung für Ihre Mühe erwarten und auch einfordern. Denn diese haben (selbstverständlich!) die erzieherische Verantwortung.
Nennen Sie Ihren Namen (Infos über Mühlengruppe)
Verraten Sie in einem kurzen Überblick, was Ihre Gäste zu sehen bekommen, und geben Sie Sicherheitshinweise! Beispiel:
Herzlich willkommen an der XX-Mühle! Ich heiße XX und begrüße Sie im Namen unserer Mühlengruppe.
Wir schauen uns die Mühle zunächst von außen an und begutachten die Technik, die hier zum Einsatz kommt. Anschließend zeige ich Ihnen die Mühle von innen. Eine Mühle ist eine Maschine mit Gefahrenstellen, deshalb bitte ich Sie, während der Führung meine Sicherheitshinweise zu beachten. Sie machen die Mühlenbesichtigung auf eigene Gefahr!
Die Sicherheit müssen Sie die ganze Zeit mit im Blick haben! Gäste machen den Rundgang auf eigene Gefahr! Sie müssen aber auf Gefahrenstellen aufmerksam machen! (Achtung Stufe! Bitte nutzen Sie das Geländer! Jetzt wird es sehr laut! ...)
Halten Sie die Aufmerksamkeit fest, indem Sie Fragen stellen (Antworten abwarten!):
Was macht man in einer Mühle? Welche Arten kennen Sie/ kennst du? … An dieser Stelle keine großen Erklärungen über Mühlenarten! Denn unabhängig von den Antworten:
Diese Fragen dienen zur Einstimmung und geben Ihnen durch den Dialog ein Gefühl für die Gäste.
Wie halten Sie weiterhin die Aufmerksamkeit der Gäste fest?
Das erreichen Sie am besten, indem Sie die Gäste einbinden:
- etwas befühlen, anfassen lassen
- Erfahrungen abfragen (Haben Sie schon einmal …)
- Schätzfragen stellen
- kleine Anekdoten (aus der Mühlengeschichte) erzählen
- einen Scherz machen
Aber alles wohl dosiert und sparsam eingesetzt!
Tipp: Achten Sie darauf, was Kinder fragen und merken Sie sich das! Das lässt sich gut in eine spätere Führung einbauen. Hier ein Beispiel:
„Ich wurde kürzlich bei einer Schulführung gefragt, wie viele Zähne hat dieses Rad? Nun, was meinen Sie?“ Und schon tun sich den Gästen neue Fragen und Erkenntnisse auf: Spielt die Anzahl eine Rolle? … / Zahn für Zahn abgezählt oder mit Formel? … / Handwerkskunst ……
Wenn Sie dieses erzählen, haben Sie auch die Lösung parat: „Ich habe das dann später ermittelt: X Zähne.“
Apropos Anzahl der Zähne: Mehr dazu in Kachel „Windkraft“ – Weg der Windkraft zum Mühlstein.
Wer heutzutage an historische Mühlen denkt, hat meistens Anlagen zum Mahlen von Getreide im Kopf. Allerdings besaßen Mühlen – und zwar ganz unabhängig davon, ob sie vom Wind, Wasser beziehungsweise mithilfe von Muskelkraft angetrieben wurden – häufig viele weitere Einsatzgebiete. Das hängt eng mit einer weitgefassten Definition des Wortes „Mühle“ zusammen. Der Historiker Peter Theißen schreibt diesbezüglich: „Unter einer Mühle wird […] ein mechanisches Werk verstanden, das aus drei wesentlichen Komponenten besteht, nämlich einem Antriebsteil, einer Kraftübertragung und einem – auf den speziellen Einsatzzweck abgestimmten, gegebenenfalls mehrgliedrigen – Antriebs- oder Arbeitsteil. Durch den Einsatz von Mühlen lassen sich gleichbleibende Tätigkeiten mechanisieren und dadurch häufig beschleunigen und erleichtern, bestenfalls sogar automatisieren.“
Die Menschen nutzten Mühlen also zu unterschiedlichen Bestimmungen, wobei sich regionale Unterschiede entdecken lassen. Der „Arbeitsteil“ wurde dabei den jeweiligen Anforderungen entsprechend angepasst. So konnte der Mahlgang reiben, schlagen, Druck erzeugen oder durch Schläge seine Wirkung entfalten. Im Folgenden sollen einige Einsatzbereiche beispielhaft aufgeführt werden:
- Herstellung von Mehl
- Lebensmittel Rapsöl
- Textilgewerbe (Bokemühle zum Brechen von Flachsstengeln; Walkmühle)
- Lohmühle (Gewinnung von Gerbstoffen)
- Metallverarbeitendes Gewerbe (Hammerwerke; Erzmühlen)
- Papiermühle
- Schöpfmühlen zum Transport von Wasser
- Steinmühle
- Zichorienmühle
Spurensuche!
Die obige Auflistung ließe sich natürlich beliebig erweitern. Welche Mühlen gibt es in Ihrer Region? Fallen Ihnen weitere Einsatzbereiche von Mühlen ein?
Entsprechend ihrer Antriebsart unterscheidet man u.a. folgende Mühlen:
Bockwindmühle
Die Bockwindmühle ist in großen Teilen Europas der vorherrschende Mühlentyp. Das Wesentliche der Bockwindmühlen ist, dass der gesamte Mühlenkörper mit Hilfe eines Sterzes (auch Steert genannt) bei wechselnder Windrichtung in den Wind gedreht werden kann. Der meist zweigeschossige Holzbau ist auf einem Bock (Balkenkreuz) und einer Mittelstütze (Hausbaum) drehbar gelagert.
Göpelmühle
Die Göpelmühle ist eine Mühle, die mit Hilfe von Mensch oder Tier angetrieben wurde. Lange bevor man die Wasserkraft zu nutzen verstand, war die Muskelkraft die alleinige Energiequelle, die zudem ständig verfügbar und billig war.
Motormühle
Die Motormühle ist eine mit Elektroenergie oder Diesel betriebene Mühle. Meistens wurde eine Windmühle zur Motormühle umgebaut oder die gesamte Mühlentechnik in einem Gebäude installiert. Somit war man dann beim Mahlen vom Wind unabhängig.
Paltrockmühle
Die Paltrockmühle ist eine technische Weiterentwicklung und gilt als ein technologisches Bindeglied zwischen Bock- und Turmwindmühle. Das drehbare Holzgehäuse ähnlich einer Bockwindmühle ruht auf einem Rollenkranz wie bei einer Turmwindmühle. Die meisten Exemplare besitzen eine Windrosette (ein kleines Windrad am Giebel der Mühle), die das Mühlengebäude selbständig in den Wind dreht. Die Paltrockmühle ist standsicherer und hat eine größere Leistungsfähigkeit. Der Name Paltrock bezieht sich auf die äußere Gestalt der Mühle, die an einen „Pfalzrock“, einer altholländischen Frauenfesttagskleidung oder an ein Mönchsgewand, einen Überrock erinnert.
Schiffsmühle
Die Schiffsmühle ist eine Sonderform der unterschlächtigen Wassermühle. Sie ist auf Schiffen erbaut und kann, je nachdem, wo der Strom am größten ist, von einem Ort zum anderen gebracht werden. Sie heben und senken sich je nach dem Wasserstand, müssen aber an Land fest verankert werden.
Turmwindmühle
Die Turmwindmühle ist eine Mühle mit drehbarer Haube oder Kappe, die auf einem Rollenkranz gelagert ist. Die Flügel sind an der Haube befestigt, so muss der Müller nicht mehr das gesamte Mühlengebäude in den Wind drehen, sondern nur noch die Haube. Ab dem 18. Jahrhundert wurden hierfür Windrosetten eingesetzt, die die Hauben selbständig in den Wind drehen. Im Unterschied zum meist achteckigen, aus Holz gebauten, holländischen Typ mit Galerie haben diese Mühlen in unserer Region einen aus Stein gemauerten, zylindrischen Turm.
Wassermühle
Die Wassermühle ist die älteste, muskelkraftunabhängige Kraftmaschine der Menschheit. Vor ungefähr 2000 Jahren, mit der Erfindung der Wasserräder, wurde zum ersten Mal die Wasserkraft zur Energieerzeugung genutzt. Unterschiede finden sich vor allem in der Bauart der Wasserräder. Es gibt ober-, mittel- und unterschlächtige Wasserräder, je nachdem in welcher Höhe das Wasser auf die Räder trifft. Damit die Mühle ausreichend Wasser zum Mahlen hatte, wurde häufig das Wasser mittels Wehr in einem kleinen Mühlenteich angestaut.